Visionen treiben Digitalisierungen an – erst Vision dann Innovation

(c) Bettina Vier – Digitalisierung + E-Commerce, „Moonlight“
Visionen treiben Digitalisierungen an
Visionen sind Vorstellungen, die unerreichbar, ja nahezu utopisch anmuten. Visionen sind Emotionen, die Menschen dazu begeistern sich für eine Sache einzusetzen. Und es braucht Mut, der Vision nachzugehen, denn auch Misserfolge müssen überwunden werden.
Ohne den Visionen von Ray Tomlinson (E-Mail), Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft, Jack Dorsey (Twitter) oder Mark Zuckerberg (Facebook) wären nennenswerte digitale Dienste, die heute zur Selbstverständlichkeit gehören, vermutlich noch Utopie.
Visionen sind Grundlage für eine Digitalstrategie mit Veränderungscharakter
Voraussetzungen für Veränderungen sind nicht technisches Know-how, sondern Vorstellungen darüber, wie in Zukunft gearbeitet werden soll. Dabei spielt es keine Rolle, welches technische und organisatorische Verständnis jemand mitbringt. Die Vision beschreibt einen Zustand, nicht die Lösung.
Beispiel: In der Biografie über Steve Jobs von Isaacson Walter wird Jobs gefragt, wie er auf die Idee kam ein Smartphone zu entwickeln. Seine Antwort war, dass er den Wunsch hatte einen Minicomputer mit sich führen zu können, um nicht immer den laptop auspacken zu können. Mit welcher Technik das umgesetzt werden könnte, war der zweite Schritt.
Das papierlose Büro – eine Vision, die noch heute Digitalisierung antreibt
Die Vision „papierloses Büro“ bedeutet ganz banal, dass alle Büroarbeiten ohne die Nutzung von Papier und überwiegend digital erfolgen sollen. Das Ziel: den Papierverbrauch minimieren, um damit die Abholzung von Wäldern zu verhindern.
Die Vision kam in den 80er Jahren auf, als binnen weniger Jahre die Computer in die Büros einzogen. Doch leider blieben die Prognosen zur Reduktion des Papierverbrauchs aus – es wurde gedruckt wie noch nie.
Trotzdem: „Visionen treiben die Digitalisierung an“ gilt für diese Vision nun schon seit 30 Jahren:
- Verstärkter Einsatz der E-Mail als Kommunikationsform auch in der offiziellen geschäftlichen Kommunikation (z.B. die digitalen persönlichen Accounts von Versicherungen)
- Touchscreens, um direkt auf dem Display schreiben zu können
- Digitale Signaturen
- Digitale Archive statt Berge von Akten
- Dokumentenmanagementsysteme, die die Arbeitsweise mit Akten nachempfinden.
- Wissensdatenbanken mit intelligenten Suchfunktionen
- Entwicklung von Tools für das kollaborative Arbeiten
- Smart-Whiteboards
Das relevante dabei: Eine Vision hat viele kleinere „Sub“-Visionen hervorgebracht. Es waren Träume, dass es für den Prozess ideal wäre, statt Papierakten zu verteilen, diese Akten digital bereitzustellen oder es waren Träume, dass was man während eines Workshops an eine Pinwand pinnt auch direkt digital weiterverarbeiten kann.
Es waren Vorstellungen, WIE man arbeiten möchte, ohne die technische Lösung zu kennen. Aber die Vorstellung des WIEs trieb die Visionäre an, die Lösungen zu finden. Die Vorstellung Dokumente, statt in Akten digital zu verwalten, brachte Dokumentenmanagementsysteme hervor. Die Vorstellung Pinnwände direkt digital verarbeiten zu können führte zu den Smart Whiteboards.
Zu wissen, wie eine Technik angewandt wird, ist keine Vision
Während in China die KI vorangetrieben wurde, weil man technische Lösungen für bestimmte Bereiche suchte, verhalten sich Deutsche wie Anwender: Sie tauschen Tipps zu Tools und Prompts für ChatGPT aus. Es wird geprüft, was ein Tool kann und dann wird überlegt, wie man das Tool am geschicktesten einsetzen kann. Im schlimmsten Fall werden die Prozesse an die Tools angepasst, d.h. die Organisation wird um die Technik herumgebaut.
Manchmal kann dieses Vorgehen von Vorteil sein, wenn es hilft, die eigenen Prozesse effizienter und effektiver zu gestalten. Teuer wird es allerdings, wenn auf wichtige Kundenservices verzichtet wird, um der Technik gerecht zu werden.
DIESES ANWENDERVERHALTEN IST WEDER EINE VISION NOCH EINE INNOVATION!
Wie aus Visionen Innovationen werden
Eine Innovation aus einer Vision entsteht immer dann, wenn man eine Vorstellung über einen zukünftigen Zustand entwickelt, zu dem man dann die passende technische Lösung sucht. Das KANN ein vorhandenes Tool sein, es kann aber sein, dass man etwas Neues entwickeln muss.
Nicht jede Innovation muss marktfähig sein. Eine Innovation kann sich auf ganz individuelle Bedarfe beziehen. Das ist häufig der Grund, warum große Firmen mitunter eigene Softwaresysteme entwickeln, weil ihnen die Marktprodukte als Lösung nicht ausreichen.
Wie aus Anwenderwissen Innovationen entstehen können
Das Wissen in der Anwendung von Tools und Systeme kann dann zu Innovationen führen, wenn ein Tool in einem ganz neuen Umfeld eingesetzt wird.
Ein Beispiel ist z.B. das GPS, dass aus dem militärischen Umfeld Einzug in die privaten PKWs fand und damit den Straßenkarten auf Papier oder dicken Atlas das Aus bescherte.
Ein weiteres Beispiel ist der 3D-Druck, der in der Industrie für Prototypen entwickelt wurde und nun in der Medizin (Prothesen) und im Bauwesen (Bauelemente) weitere Anwendungsfelder gefunden hat.
Methoden, um innovative Visionen zu entwickeln
In der Durchführung von Workshops mit dem Ziel „Visionen treiben Digitalisierungen an“ haben sich bereits einige Methoden entwickelt, Mitarbeiter zu motivieren, neue Ideen zu entwickeln. Im folgendem die vermutlich beliebtesten Methoden:
- Design Thinking (relevant: Nutzerbedürfnisse erkennen bevor der Nutzer selbst weiß, dass er das Bedürfnis hat)
- Szenarien (was wäre wenn)
- Moonshot Thinking (was wäre, wenn wir kein Limit hätten)
- Reverse Thinking (Wie erreicht man das Gegenteil)
- Megatrends (Welche langfristigen globale Veränderungen finden, statt und was bedeutet das für mein Unternehmen)
Fazit: Für innovative Visionen braucht es Mut
Alle Innovatoren verbindet eins: Mut eine „verrückte“ Idee zu äußern, die Vorteile der Idee erkennen und Mut und Ausdauer so lange zu recherchieren und zu forschen, bis sie realistisch wird. Sie alle haben sich frei von Limits bewegt und ihre Idee sozusagen im luftleeren Raum entwickelt: keine technische Rahmen (z.B. durch ein System), keine Berücksichtigung rechtlicher Rahmen (der rechtliche Rahmen für Social Media wurde erst nach dem Livegang und dem Erfolg von Facebook entwickelt).
Meine Empfehlungen zum Weiterlesen:
- Was ist Ihre E-Commerce-Strategie?
- Wegrationalisierung als Booster – Wie ich mich selbst überflüssig machte
- Der ideale Einstieg und Ablauf in eine nachhaltige digitale Transformation

 (c) Bettina Vier - Digitalisierung und E-Commerce
(c) Bettina Vier - Digitalisierung und E-Commerce Thomas Reimer; Adobe Stock
Thomas Reimer; Adobe Stock
 (c) wetzkaz - stock.adobe.com #602448151
(c) wetzkaz - stock.adobe.com #602448151
 (c) alotofpeople - stock.adobe.com #362306286
(c) alotofpeople - stock.adobe.com #362306286
 (c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce, 2023
(c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce, 2023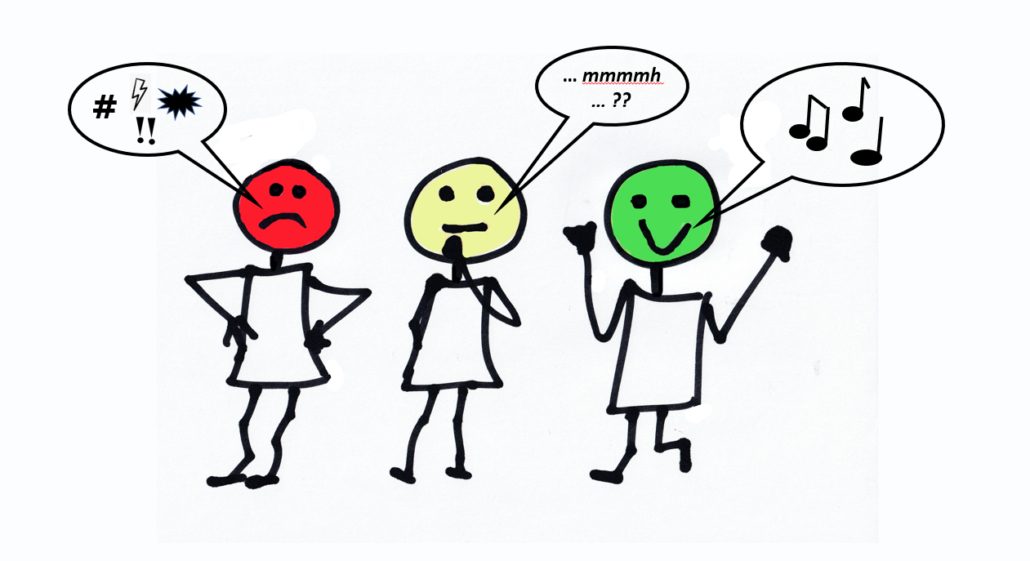
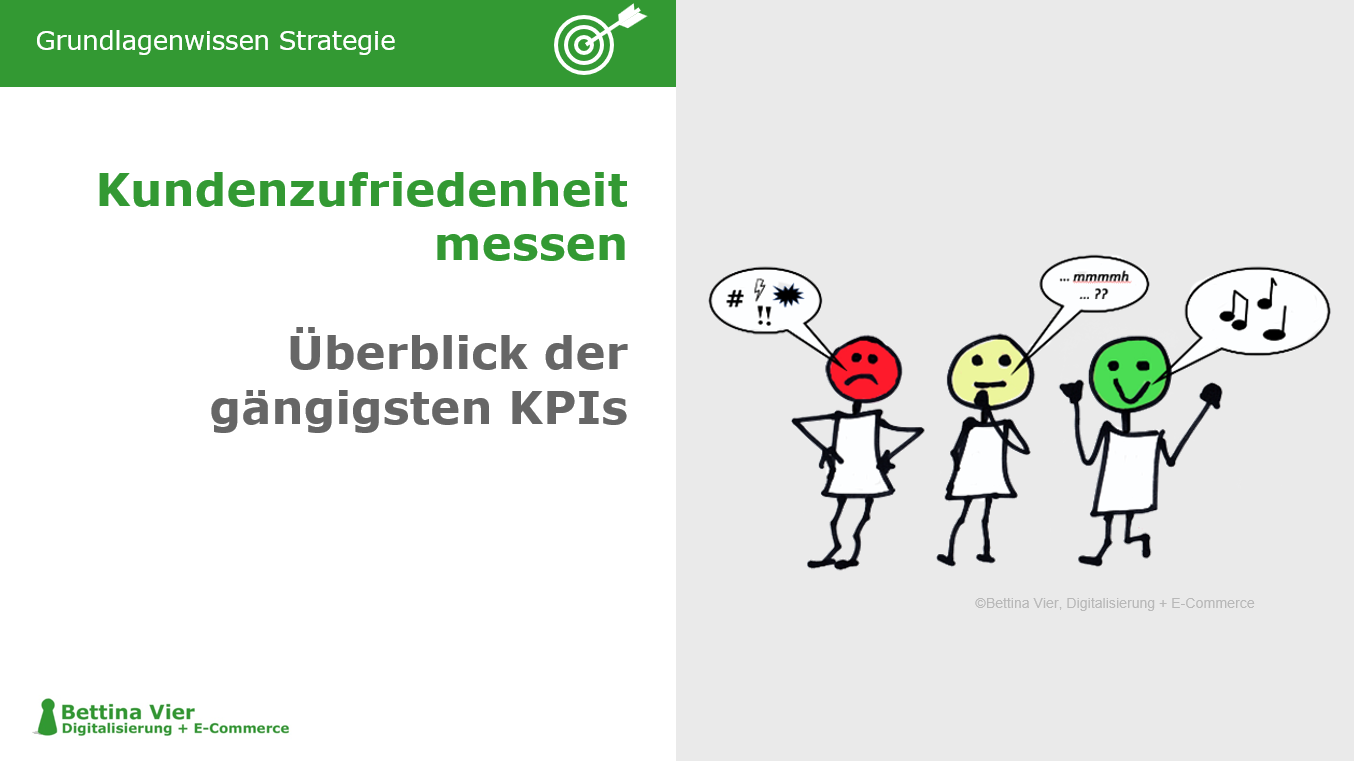



 Best Practice Verlag
Best Practice Verlag (c) phonlamaiphoto - stock.adobe.com #270891330
(c) phonlamaiphoto - stock.adobe.com #270891330