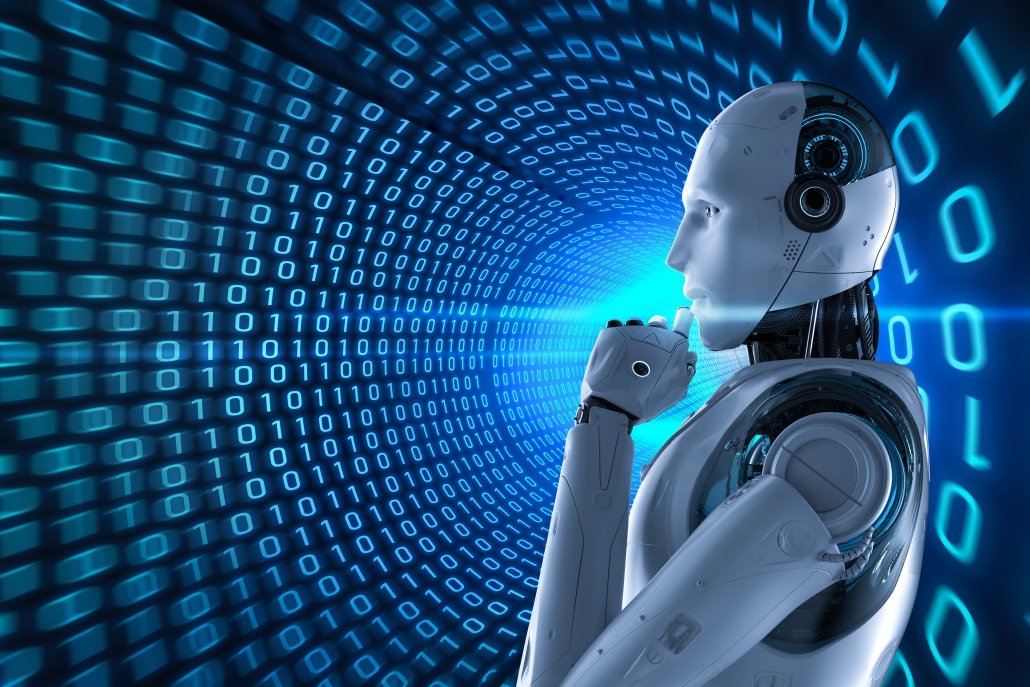Vakanzüberbrückung bis Spezialauftrag – Wann Interim-Manager einer Festanstellung vorzuziehen sind

Gajus – stock.adobe.com #183127295
Interim-Manager und festangestellte Manager stehen nicht in Konkurrenz
Ein Interim-Manager ist ein:e freiberufliche Manager:in, der/die temporär eine Aufgabe mit Führungskompetenz in einem Unternehmen übernimmt: Von der Vakanzüberbrückung bis zu Sonderaufträgen.
Interimistische Führungskräfte sind dann vorteilhafter als eine Festanstellung, wenn Zeit, Veränderungsdruck oder spezielle Expertise entscheidend sind:
Interim-Management = Geschwindigkeit + Erfahrung + Flexibilität
Festanstellung = Kontinuität + Bindung + langfristiger Aufbau
Situation 1: Vakanzüberbrückung und Engpässe
Der plötzliche Ausfall einer Führungskraft kann dazu führen, dass Teams nicht mehr richtig funktionieren. Häufig bleiben zudem wichtige Projekte und Aufgaben liegen.
- Plötzliche Ausfälle: Krankheiten, Tod, Kündigungen
- Geplante Ausfälle: Elternteilzeit, Krankheiten
Sie können die Situation nutzen, um in ein Team neue Strukturen einzuführen. So kann eine neue festangestellte Führungskraft ein vorbereitetes Team übernehmen und sich direkt strategischen Themen widmen.
Situation 2: Krisensituationen
In Krisensituationen ist ein neutraler erfahrener Blick für Störungen, fehlende Strukturen, falsche Einschätzungen und unklaren Finanzsituationen erforderlich. Zudem bedarf es einer talentierten Führungskraft, die aus Unruhe und Hektik Produktivität und Zukunftsperspektiven formt:
- Unternehmenskrisen (z.B. eine Insolvenz aus eigener Kraft stemmen)
- Restrukturierungen
- Turnarounds
- Projekte in Schieflage
Situation 3: Benötigtes Spezialwissen gepaart mit Führungskompetenz (zeitlich befristet)
Wenn Aufgabe spezielle Erfahrungen und Wissen benötigen und die eigenen Kapazitäten erschöpft sind, empfiehlt es sich, auf Interim-Manager zurückzugreifen, z.B.:
- Aufbau- / Schließung von Geschäftsbereichen oder Niederlassungen
- Einführung von IT-Systemen
- M&A-Projekte
- Carve-outs
- Post-Merger-Integration
- Compliance, Governance, ESG
- Internationalisierung oder Markteintritt
Situation 4: Veränderungs- und Transformationsphasen
In Phasen von Veränderungen bringen Interim-Manager nicht nur Erfahrungen mit, sondern können aufgrund ihrer Neutralität den Blick auf außen wahren und die Veränderungen ohne Eigeninteressen umsetzen. Interne Mitarbeiter sind in solchen Phasen häufig durch eigene Interessen (z.B. Karriereplanung) voreingenommen und blockiert.
- Digitale Transformation
- Kulturwandel, Reorganisation, Prozessoptimierung
- Einführung neuer Führungs- oder Steuerungsmodelle
Situation 5: Politisch oder emotional sensible Situationen
In politisch oder emotional sensible Situationen hilft ein neutraler erfahrener Blick und Unabhängigkeit schwierige Aufgaben zu übernehmen und das Handeln auf unternehmerisch wichtige Faktoren zu lenken.
Generationenwechsel in einem Familienunternehmen
- Personalabbau und Standortschließungen
- Personalkonsolidierung und Umstrukturierung im Umfeld von Übernahmen
Situation 6: Strategische Neuausrichtung
Die Unternehmensführung hat erkannt, dass das Unternehmen eine Neuausrichtung benötigt, ist sich aber noch nicht sicher, wie sie konkret aussehen soll. Hier können erfahrene Interim Manager in folgenden Themen aktiv unterstützen:
- Objektive Standortbestimmung
- Entwicklung einer realistischen Zielstrategie
- Beschleunigung von Entscheidungen
- Übersetzung der Strategie in Umsetzung
- Führung in der Übergangsphase
- Umgang mit Widerständen
- Aufbau nachhaltiger Strukturen
Wie können Interim-Manager beauftragt werden?
Eigenrecherche
Sie können via LinkedIn oder ausgewiesenen Marktplätzen für Interim-Manager selbst auf die Suche gehen. Viele Interim-Manager besitzen auch eine eigene Website auf der sie ihre Erfahrungen, ihr Spezialwissen und Kompetenz vorstellen.
Recherche mit Unterstützung eines Providers
Ein Provider ist eine Personalagentur, die sich darauf spezialisiert hat Interim-Manager zu vermitteln. Adressen finden Sie hier:
- Arbeitskreis Interim Management Professionals (AIMP)
- Dachverband deutscher Interim-Manager (DDIM)
- Suche auf Google: provider interim management deutschland
Hier können Sie sich die Inhalte des Beitrags als PDF herunterladen:

Wann Interim-Management
sinnvoller ist als eine Festanstellung (PDF)
Meine Empfehlungen zum Weiterlesen:
- Scheinselbständigkeit kann vermieden werden
- Vorlage für den Projektstart – schnelles Onboarding von Externen
- Praxisbeispiel für eine Vakanzüberbrückung: Digitalisierung der Geschäftsprozesse bei einem Startup mit transformationale Führung

 (c) Gajus - stock.adobe.com #183127295
(c) Gajus - stock.adobe.com #183127295 Andrey Popov - stock.adobe.com #78921039
Andrey Popov - stock.adobe.com #78921039
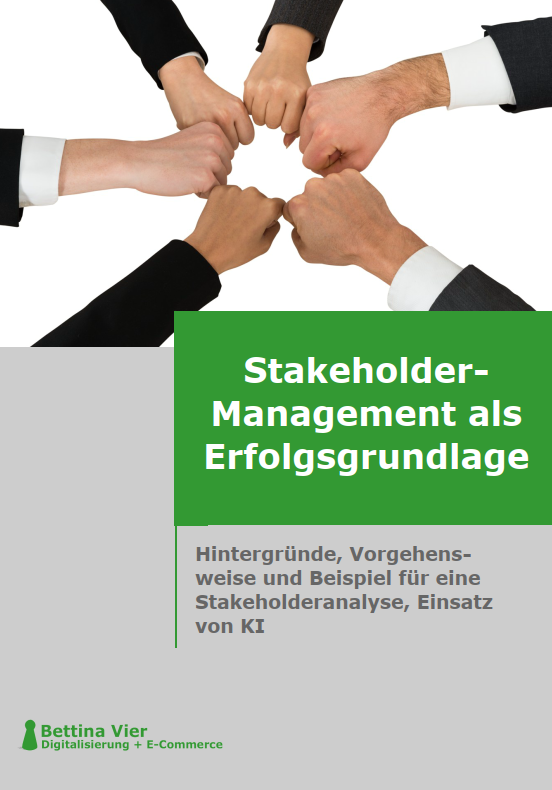
 (c) wetzkaz - stock.adobe.com #602448151
(c) wetzkaz - stock.adobe.com #602448151
 (c) alotofpeople - stock.adobe.com #362306286
(c) alotofpeople - stock.adobe.com #362306286
 (c) 1STunningART - stock.adobe.com #270961904
(c) 1STunningART - stock.adobe.com #270961904


 Bettina Vier
Bettina Vier
 (c) phonlamaiphoto - stock.adobe.com #270891330
(c) phonlamaiphoto - stock.adobe.com #270891330